Systeminkongruente Regelungen im deutschen Umwandlungssteuerrecht
Umstrukturierungen nach dem UmwStG im Lichte von Rechtsprechung und Finanzverwaltung
- Beleuchtung von Finanzrechtsprechung und Finanzverwaltung
- Aufzeigen überschießender bzw. lückenhafter Regelungen im geltenden Umwandlungssteuerrecht
- Unterbreitung von Reformvorschlägen zum UmwStG
Matthias Alber untersucht in seiner Dissertation die Herausforderungen und Zielsetzungen des Gesetzgebers bei der Gestaltung des UmwStG und analysiert, inwieweit der Gesetzgeber die Balance zwischen Flexibilität und Begrenzung erfolgreich umsetzen konnte.
Mehr Produktinformationen| Bestell-Nr.: | E13142APDF |
|---|---|
| ISSN: | |
| ISBN: | 978-3-7910-6781-0 |
| Auflage: | 1. Auflage 2025 |
| Umfang: | 340 Seiten |
| Einband: | |
| Produktart: |
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.





DIESES PRODUKT TEILEN
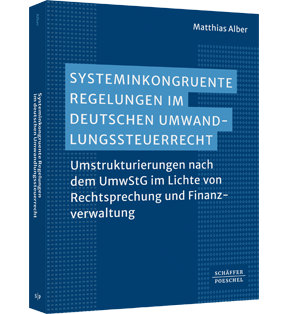
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
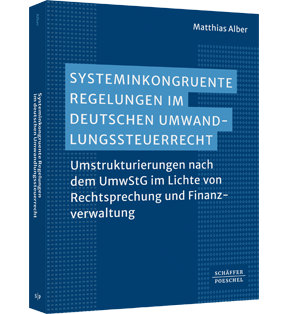
Produktinformationen
Der Gesetzgeber des UmwStG sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, Regelungen zu schaffen, die es einerseits den Unternehmen ermöglichen, ihre Strukturen an den Erfordernissen des Wirtschaftslebens auszurichten, ohne dass damit steuerliche Belastungen einhergehen. Andererseits musste der Gesetzgeber darauf achten, rein steuerliche und damit nicht begünstigte Statusverbesserungen zu definieren und zu begrenzen. Inwieweit dies gelungen ist, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Dabei findet vor allem eine Auseinandersetzung mit der Sichtweise der Finanzverwaltung sowie der Rechtsprechung der Finanzgerichte statt, die in der praktischen Anwendung und damit auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von herausragender Bedeutung sind.
Der Gesetzgeber des UmwStG sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, Regelungen zu schaffen, die es einerseits den Unternehmen ermöglichen, ihre Strukturen an den Erfordernissen des Wirtschaftslebens auszurichten, ohne dass damit steuerliche Belastungen einhergehen. Andererseits musste der Gesetzgeber darauf achten, rein steuerliche und damit nicht begünstigte Statusverbesserungen zu definieren und zu begrenzen. Inwieweit dies gelungen ist, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Dabei findet vor allem eine Auseinandersetzung mit der Sichtweise der Finanzverwaltung sowie der Rechtsprechung der Finanzgerichte statt, die in der praktischen Anwendung und damit auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von herausragender Bedeutung sind.
Der Gesetzgeber des UmwStG sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, Regelungen zu schaffen, die es einerseits den Unternehmen ermöglichen, ihre Strukturen an den Erfordernissen des Wirtschaftslebens auszurichten, ohne dass damit steuerliche Belastungen einhergehen. Andererseits musste der Gesetzgeber darauf achten, rein steuerliche und damit nicht begünstigte Statusverbesserungen zu definieren und zu begrenzen. Inwieweit dies gelungen ist, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Dabei findet vor allem eine Auseinandersetzung mit der Sichtweise der Finanzverwaltung sowie der Rechtsprechung der Finanzgerichte statt, die in der praktischen Anwendung und damit auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von herausragender Bedeutung sind.
| Bestell-Nr.: | E13142APDF | |
|---|---|---|
| ISSN: | ||
| ISBN: | 978-3-7910-6781-0 | |
| Auflage: | Auflage/Version: | 1. Auflage 2025 |
| Umfang: | 340 | |
| Einband: | ||
| Produktart: |
Prof. Dr. Matthias Alber, ehem. Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg; Autor von zahlreichen Fachbüchern und Mitautor in Dötsch et al., Die Körperschaftsteuer; Dozent im Rahmen der Aus- und Fortbildung für Steuerberater.
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einführung
I Problemstellung
II Zielsetzung
III Gang der Untersuchung
B Grundlagen des Umwandlungssteuerrechts
I Systematik des UmwStG
1 Regelungszweck des UmwStG
2 Regelungsfolgen des UmwStG
3 Umwandlungsmotive
4 Verhältnis zu anderen Vorschriften und Rechtsprinzipien
II Anwendungsbereich des UmwStG (§ 1 UmwStG)
1 Ausgangspunkt
2 Sachlicher Anwendungsbereich
3 Persönlicher Anwendungsbereich
4 Wichtige Definitionen für das UmwStG (§ 1 Abs. 5 UmwStG)
III Bewertungsmöglichkeiten nach dem UmwStG
IV Rückwirkung im UmwStG (§ 2 UmwStG)
1 Wesentlicher Inhalt
2 Verlängerung der Rückwirkungsfrist für 2020 und 2021
3 Beschränkung der Verlustnutzung (§ 2 Abs. 4 Sätze 1 und 2 UmwStG)
4 Ausschluss der Verrechnung positiver Einkünfte im Rückwirkungszeitraum (§ 2 Abs. 4 Sätze 3 – 6 UmwStG)
5 Neuregelung für den Rückwirkungszeitraum (§ 2 Abs. 5 UmwStG)
V Steuerliche Behandlung von Umwandlungskosten
1 Grundsätze zur Behandlung von Umwandlungskosten
2 Zusammenfassende Übersicht
3 Abgrenzung der Umwandlungskosten
C Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen
I Geltende Rechtslage
1 Besteuerung einer Kapitalgesellschaft im geltenden Recht
2 Anwendungsbereich der §§ 3–9 UmwStG
II Systeminkongruente Regelungen
1 Zur Aufdeckung stiller Reserven im Falle einer Auslandsbetriebsstätte nach § 4 Abs. 4 Satz 2 UmwStG – ist dies systemgerecht?
2 Gewinnerhöhung durch Aufzinsung des KSt-Guthabens nach Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, an der nur Kapitalgesellschaften beteiligt sind?
3 Zur Behandlung des Übernahmegewinns nach § 4 Abs. 4 UmwStG als Gewinn i. S. d. § 34a Abs. 2 EStG
4 Vernichtung von Anschaffungskosten nach § 4 Abs. 6 Satz 4 und Satz 6 UmwStG
5 Steuerliche Behandlung von Übernahmefolgegewinnen nach § 6 UmwStG
6 Ist die Ausschüttungsfiktion nach § 7 UmwStG systeminkongruent?
7 Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft zur Vermeidung der Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG
8 Besonderheiten bei ausländischen Gesellschaftern
9 Gewerbesteuer nach § 18 Abs. 3 UmwStG
III Zwischenfazit
D Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
I Geltende Rechtslage
1 Besteuerung von Gewinnen
2 Berücksichtigung von Verlusten
3 Verlustabzugsbeschränkung nach §§ 8c und 8d KStG
II Systeminkongruente Regelungen
1 Reihenfolgeproblem des § 8b Abs. 2 Satz 4 KStG in Verschmelzungsfällen
2 Pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot von 5 % bei Aufwärtsverschmelzung auf eine Organgesellschaft
3 Gewinnrealisierung bei Abwärtsverschmelzungen
4 Grenzüberschreitende Verschmelzungen
5 Verschmelzung nach Forderungsverzicht gegen Besserungsschein
6 Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft ist kein Gestaltungsmissbrauch i. S. d. § 42 AO
III Zwischenfazit
E Spaltung von Kapitalgesellschaften (§ 15 UmwStG)
I Geltende Rechtslage
1 Voraussetzungen
2 Rechtsfolgen
II Systeminkongruente Regelungen
1 Auslegung des EU-Teilbetriebsbegriffs
2 Spaltungshindernisse
3 Auslegung der Nachspaltungsveräußerungssperre von 20 % in § 15 Abs. 2 Sätze
2 bis 4 UmwStG
4 Drittstaatenspaltung mit deutscher Körperschaft als Gesellschafter
III Zwischenfazit
F Einbringung von Personenunternehmen in eine Kapitalgesellschaft (§§ 20–23 UmwStG)
I Geltende Rechtslage
1 Besteuerungsvergleich Personenunternehmen und Kapitalgesellschaft
2 Einbringungsvoraussetzungen nach §§ 20 ff. UmwStG
II Systeminkongruente Regelungen
1 Zur Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung
2 Das Problem mit dem Negativkapital nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG
3 Sonstige Gegenleistungen im Rahmen der »Lex Porsche« nach §§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4, 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UmwStG
4 Unerkanntes Betriebsvermögen
5 Umwandlung einer Tochter-KG auf die Mutter-GmbH
6 Folgeumwandlungen bei Einbringungen nach §§ 20, 21 UmwStG
7 Auslandsgesellschafter als Umwandlungssperre?
III Zwischenfazit
G Einbringung von Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft (§ 24 UmwStG)
I Geltende Rechtslage
1 Einbringungsvoraussetzungen nach § 24 UmwStG
2 Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten
3 Einbringung in das Sonderbetriebsvermögen
4 Kein Übergang zur Bilanzierung erforderlich
5 Ergänzungsbilanzen (Brutto- bzw. Nettomethode)
6 Abgrenzungsfragen zu § 6 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG
II Systeminkongruente Regelungen
1 Einräumung von Gesellschaftsrechten nur bei Verbuchung im Kapitalkonto I
2 Zur Anwendung des § 24 Abs. 5 UmwStG
3 Praxisfall: Einbringung Freiberuflerpraxis in eine Freiberuflersozietät
4 Einbringung in eine Personengesellschaft mit Auslandsbezug
III Zwischenfazit
H Schlussbetrachtung und abschließendes Fazit
I Zielsetzung der Dissertation
II Leit- und Grundprinzipien
III Subjektsteuerprinzip versus UmwSt-Recht
IV Teilglobalisierung des Umwandlungssteuerrechts
V Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen
VI Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
VII Spaltung von Kapitalgesellschaften
VIII Einbringung von Personenunternehmen in eine Kapitalgesellschaft und Anteilstausch (§§ 20–23 UmwStG)
IX Einbringung von Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft nach § 24 UmwStG
X Abschließendes Fazit
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Autor
DIESES PRODUKT TEILEN
